SUB
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
Schriftliches
Kulturgut
Die SUB ist Mitglied
der „Allianz Schriftliches Kulturgut erhalten“. Sie
wurde 2001 als Interessenvertretung von Archiven und Bibliotheken mit
umfangreichen historischen Beständen gegründet. Ihr Ziel ist es, die Erhaltung
von schriftlichem Kulturgut als nationale Aufgabe zu etablieren und ein
öffentliches Bewusstsein dafür zu schaffen, dass dieses Ziel einer beständigen
Arbeit bedarf.
Schriftliche Dokumente,
Bücher, Akten - erhalten, sichern oder wegwerfen?
Am 12.11.16 ist Nationaler Aktionstag für Bestandserhaltung
2016 In diesem Jahr richtet ihn die Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
(SUB)Göttingen im Historischen Gebäude Papendiek 14 von 14 bis 19 Uhr
ein Programm mit Vorträgen, Diskussionen, Führungen und Mitmachveranstaltungen
aus. Die Teilnahme ist kostenlos.
Programm
14:00 Uhr Begrüßung (Alfred-Hessel-Saal)
14:30 Uhr Podiumsdiskussion (Alfred-Hessel-Saal)
16:00
Uhr Vorstellung einzelner Projekte zu Konservierung und Restaurierung
schriftlichen Kulturguts (Vortragsraum)
-- Wasserschaden-Projekte (Dr. Johannes Mangei)
-- Kartenrestaurierung (Mechthild Schüler und Magdalena Schumann)
-- Die Sanierung einer halben Million brandgeschädigter Bücher mittels
Trockeneis und Aktiv-Sauerstoff (Renate van Issem
und Sandra Hildebrandt)
-- Rettung der Timbuktu-Manuskripte (Eva Brozowsky)
-- Bücher schützen beim Bauen und Möblieren (Almuth Corbach)
18:00
Uhr Abendvortrag „Zeitkapseln. Vom Nutzen und Nachteil des Wegwerfens"
von Prof. Dr. Dr. h.c. Heinrich Detering (Akademie
für Sprache und Dichtung und Universität Göttingen)
Führungen
Treffpunkt für alle Führungen
ist der Info-Point im unteren Foyer des Historischen Gebäudes.
-- Restaurierungswerkstatt (14:30 Uhr, 15:30 Uhr und 16:30 Uhr)
-- Ausstellung Conn3ct (14:30 Uhr, 15:30 Uhr und 17:00 Uhr) „Conn3ct – 2 media, 1 story“, ein Projekt der Kulturerbebibliothek
Flandern und der Nationalbibliothek der Niederlande in Den Haag in Kooperation
mit der SUB Göttingen, demonstriert in einer interaktiven Ausstellung,
welchen Einfluss neue Medien auf die Menschheit und die Welt, in der wir
leben, haben. Sie stellt heutiger Social Media
einige der ersten gedruckten Bücher gegenüber, um zu zeigen, dass es sich
hierbei um entfernte Verwandte handelt.
-- Digitalisierungszentrum (15:00 Uhr, 16:00 Uhr und 17:00 Uhr)
-- Historische Bibliothek (15:00 Uhr, 16:30 Uhr und 17:30 Uhr)
-- Kartensammlung (15:00 Uhr und 17:30 Uhr)
Deutsche Sprache
Beiträge zur Entstehung einer
allgemeinen deutschen Hochsprache
- Ausstellung "Sprachkritik als Aufklärung - Die Göttinger 'Deutsche
Gesellschaft' im 18. Jahrhundert"
Ausstellung vom 16. 4. bis zum 21. 5. 2004 im Foyer
der SUB (Staats- und Universitätsbibliothek) Göttingen. Eröffnung am 16.4.04.
Öffnungszeiten Mo. - Fr.: 09.00 - 22.00 Uhr, Sa: 10.00 - 17.00 Uhr
 |
Blick von der Galerie im 1. Stock auf die
Ausstellungsfläche im Erdgeschoß der SUB |
Es ist dem Augenschein nach eine Ausstellung von
aufgeschlagenen Büchern und erläuternden Schautafeln. Die Eröffnungsveranstaltung legt
die Vermutung nahe, dass diese Ausstellung darüberhinaus etwas zeigen will, was jedoch
nicht mit ausgestellten Büchern und Schautafeln allein vermittelt werden kann: der
mühevolle Entstehungsprozeß einer einheitlichen Deutschen Sprache wie wir sie heute
selbstverständlich zu nutzen gewohnt sind. Dieses zu beleuchten, war die Eröffnungsrede
des Prof. Henne aus Braunschweig nötig, ohne den gehört zu haben, der Besuch der
Ausstellung einen Großteil an Reiz entbehrt hätte.
Hatte der einleitende Redner nur davon gesprochen, dass wir für unsere Sprache selbst
verantwortlich seien und wir sie sich nicht selbst überlassen könnten, so nuancierte
Henne wohltuende mit dem Hinweis, die Pflege und Weiterentwicklung der Muttersprache durch
ein Volk könne sich nur in Freiheit entfalten. Jakob Grimm hatte ebendies vor 170 Jahren
in seiner Antrittsvorlesung "Über die Heimatliebe" formuliert.

Prof. Dr. Helmut Henne (TU Braunschweig, Seminar für deutsche Sprache und Literatur,
Abteilung Germanistische Linguistik) Dudenpreis 1995 |
Prof. Henne bewirkte beim Publikum durch überraschende
Performance ein Gefühl für Sprache: er begann seine Rede mit einer Begrüßung in
lateinischer Sprache und schien auch danach nicht geneigt zu sein, zu allen
verständlicher deutscher Sprache zurückzukehren. Das Publikum begann zu befürchten, er
beabsichtige einen längeren Vortrag ausschließlich in Latein zu halten. Aber nein, er
las lediglich den Anfang jener Antrittsvorlesung Jakob Grimms im Original.
|
Henne gelang es in seinem Vortrag eine gewisse Ehrfurcht
und Dankbarkeit hervorzurufen für den von ihm beschriebenen historischen Prozeß, der uns
schließlich eine verbindende Sprache bescherte, eine Sprache die geographische,
kulturelle und soziale Sprachgrenzen überwand.
Hochdeutsch konnte damals als überregionale Sprache nur etabliert werden indem es die
französische Sprache ablöste. dass sich die Wissenschaft einer einheitlichen Deutschen
Sprache bedienen möge, war zunächst einmal nur eine Forderung von Gottfried Wilhelm
Leibniz gewesen. Die Verbindung der wissenschaftlichen Sprachwelt mit denen der Kultur und
des Alltags und das auch noch über die Regionen hinweg war der nächste Schritt. Ziel war
die gemeine, wissenschaftliche und überregional verbindende Sprache. Die Durchlässigkeit
zwischen ästhetischer Sprache, Literatursprache, gelehrter Sprache und Alltagssprache
mußte gegen Widerstände jener durchgesetzt werden, die wie die Literaten abgeschlossene
Sprachenklaven beibehalten wollten.
Die Zeugnisse für diesen langwierigen Prozeß der Sprachvereinheitlichung sind
Wörterbücher wie z.B, das von Adelung der ein Standardwerk der deutschen Sprache
erstellte inclusive Orthographie, Wörterbuch sowie Hinweisen auf die Aussprache.

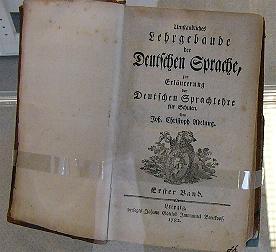
Johann Christoph Adelung (Bild links) Text auf dem Titelblatt rechts: "Umständliches
Lehrgebäude der Deutschen Sprache zur Erläuterung der Deutschen Sprachlehre für
Schulen, Leipzig, Breitkopf 1782"
Im Zuge der Standardisierung gab es die Irrwege der
Sprachpuristen, die wie Kamper jeglichen Fremdeinfluß ins deutsche übersetzen wollten.
Es gab die Forderung nach sorgfältiger Differenzierung in der Sprache, weil dies die
Voraussetzung für deren Verwendbarkeit darstelle - von Henner erläutert am Beispiel
Landsmann und Landmann wie es Gottsched (eisnt Vorsitzender der Leipziger Deutschen
Gesellschaft) dargestellt hatte.
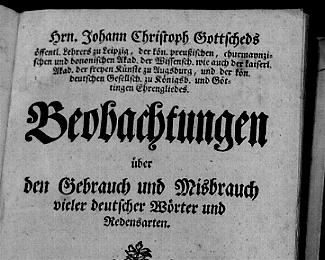 |
Johann Christoph Gottsched gründete 1727 in Leipzig die
"Deutsche Gesellschaft" - das Vorbild der Göttinger Deutschen Gesellschaft |
Schließlich interessant, dass Michaelis (zu dessen Ehren
das Michaelishaus in der Prinzenstraße benannt ist) sich irgenwann beklagte, dass zwar
die Predigten in Hochdeutsch gehalten würden, die Bauern diese aber nicht verstünden und
deshalb wieder niederdeutsch bei den Predigten eingeführt werden solle.
Mit Hilfe der ausgestellten Bücher und Schautafeln konnte man anschließend noch einmal
die Stationen nachverfolgen, die Henne in seinem Vortrag in flüssige Verbindung gebracht
hatte. Für den nicht spezialisierten Besucher wird sich die Ausstellung nur schwer
erschließen. Ob der recht teuere Katalog (16 Euro) hier weiterhilft, kann nicht beurteilt
werden, weil man sich seitens der Aussteller aufgrund von knappen finanziellen Mitteln
nicht dazu entschließen konnte, ein Exemplar für die Presse abzugeben. Allerdings wurde
glaubhaft versichert, der Katalog sei sowieso eher etwas für Wissenschaftler. Der Katalog
wird doch nicht etwa in Latein oder Französisch abgefaßt sein? Das würde einen
Rückfall in Zeiten vor der Einführung des allgemein verständlichen Hochdeutschen
indizieren.

Eröffnung der Ausstellung am 16.4.04 im großen Seminarraum
der SUB, Mit vielen auswärtigen Gästen
Die Schautafeln vermitteln an einigen Stellen den Eindruck
als ob sich die institutionelle Sprachforschung ins rechte Licht rücken möchte:
"Sprachkritik ist Beschreibung und Bewertung von sprachlichem Verhalten oder
sprachlichen Mitteln zum Zwecke der Optimierung und auf der Basis unterschiedlicher
Kriterien. Sie kann auch mit einer systematischen Analyse von von Sprache
(Sprachwissenschaft) verbunden sein." "Sprachkritik kann Bestandteil
alltäglichen Sprachhandelns und Sprachbewußtseins aber auch Ziel und Ergebniss
professioneller Tätigkeiten sein. Professionelle Sprachkritik findet in Form von Urteilen
einzelner Experten (z.B. in bestimmten Publikationen ) in der Praxis öffentlich wirksamer
Sprachvereine oder in offiziellen Institutionen (z.B. Akademien, Forschungstinstituten)
statt".
Ob es gelänge, Besucherinnen und Besuchern nichtphilologischer Provinienz einen Sinn zu
vermitteln, scheint nicht Gegenstand intensiver Reflexion gewesen zu sein. Das Betrachten
von aufgeschlagenen Büchern hat nur einen begrenzten Reiz. Doch den Eröffnungsvortrag
von Prof. Henne anzuhören hatte sich allemal gelohnt.
In Übereinstimmung mit den Grundregeln der "Deutschen
Gesellschaft" Göttingen, 1738 schließt unser Artikel an dieser Stelle:
§ 21 Man soll sich bey allen Erinnerung der Bescheidenheit und Kürze befleissigen, auch
wender jemahls dem andern ins Wort fallen noch unter währender Beurtheilung besonders
Gespräche führen.
 |
Sprache entwickelt sich in Freiheit, in diesem Sinne
"ungezwungen und richtig" Bild links:
Buchtitel eines der ausgestellten Exponate im aufwendig textil gestalteten Einband. |
zum Anfang |