"Der größte Zwerg"
Theaterstück über
Georg Christoph Lichtenberg (GCL)
Zur
>Hauptseite zum Thema Lichtenberg
in goest
> Jährliche Gedenkfeier am Grabauf
dem Bartholomäus-Friedhof in Gö
Junges
Theater
"Der größte Zwerg
Das
Leben des Georg Christoph Lichtenberg verlief immer wieder sehr unkonventionell,
und es fand zum allergrößten Teil in Göttingen statt. Georg Christoph
Lichtenberg wurde bis heute weder auf die Bühne gebracht noch verfilmt.
Mit „Der größte Zwerg“ stellte das Junge Theater nun ein Theaterstück
über das Leben Lichtenbergs vor. Premiere war am 24. Februar, dem
Todestag von GCL, 2017 im Jungen Theater

Die
Schauspieler*innen: Peter Christoph Scholz (vorne); Linda Elsner , Jan
Reinartz , Agnes Giese , Karsten Zinser , Franziska Lather / Foto (c)
Dorothea Heise
25.2.17
/ G. Schäfer
Die Inszenierung war von der detaillierten Sachkenntnis des Autors und
Historikers Peter Schranz geprägt. Von der Geburt GCLs bis zum Tode
war es eine Parforcejagd durch die >>Biografie
von GCL. Um die vielen Andeutungen im Stück einordnen zu können
setzte schon Kenntnisse über die Biografie GCLs voraus.
Ein
Lichtbergkenner meinte u.a. zur Premiere: "eindrucksvoll und nachdenklich
die Tanzszene und der Brief an Amelung nach dem Tod der Stechardin,
viel O-Ton im "Baldinger-Brief" (Cheapside > und Fleetstreet ...), toll
inszeniert die Helgolandfahrt!"
[ebendiese
Details sind auch dem goest-Rezensenten bereits teiweise entgangen]
Das
Stück wirkte insgesamt wie eine Aneinanderreihung von Fußnoten
in der Form aufblitzender Bilder: hier eine Andeutung, da eine Andeutung,
allenfalls kurze Erläuterungen. Zu kurz, denn hinter den Andeutungen
lauerten umfangreiche Geschichten. Die Expert*innen der Lichtenberggesellschaft,
die im Rahmen ihrer Jahrestagung in Göttingen demnächst sicherlich
das Stück anschauen werden, haben sicher ihre wahre Freude an dem
Stück. An weniger Informierten werden viele Andeutung aber vorbeihuschten.
Obwohl die Elektrizitätsversuche Lichtenbergs noch zu den bekanntesten
Tatsachen seiner wissenschaftlichen Tätigkeit gehören, mag sich
dennoch mancheine/r gefragt haben, welchen Sinn das Auftauchen einer die
Stofftier-Katze haben soll, die plötzlich ins Spiel kam. Sie sollte
daran erinnern, dass GCL bei seinen Vorlesungen zur Demonstration
die Haare einer Katze elektrostatisch auflud. Bei der Darstellung der
Experimente war das Theater übrigens aus Sicherheitsgründen
stark eingeschränkt; die JT-Bühnentechnik hatte sich aber allerhand
einfallen lassen und illustrierte die Experimente einfallsreich mit Gasballons,
Lichtgeräten und Nebelmaschine. Die naturwissenschaftliche Souveränität
Lichtenbergs blitzte im Stück aufs allerknappste und dennoch
erfrischende Weise auf, als Lichtenberg ausrief: "Goethes
Farbenlehre? Alles Schrott!" (womit er ziemlich recht hatte).
GCL hat nach einem Treffen mit Goethe immerhin eine 4 Jahre dauernde Korrespondenz
mit ihm geführt.
Lichtenbergs elektromagnetischen Experimente, die zu späteren Zeiten
in die Erfindung des Fotokopierers mündeten wurde durch die demonstrative
Benutzung eines Fotokopierers in einer Ecke der Bühne gewürdigt.
Apropos Bühne: Auf der Bühne wurde kaum gespielt. Fast alles
fand im Zuschauer*innenraum statt. Dieser war geteilt: links und rechts
Publikum, in der Mitte eine Reihe mit 4 Tischen. Das bedeutete, dass die
Schauspieler*innen oft erst der einen und dann der anderen Hälfte
des Publikums den Rücken zukehrten. Rund um die Tische herum, auf
den Tischen, unter den Tischen, zwischen den Tischen und mit den Tischen
lief dann ein fortdauerndes Spektakel ab. Ein bisschen zu klamaukhaft
vielleicht, ein bisschen zu viel Geschrei und Gerenne rund um die Tische
- als wolle man einen Aufführungsgeschwindigkeitsrekord aufstellen.
Andererseits aber auch herrlich kreativ die Verwendung zweier Tische zur
Simulation von Lichtenbergs Seefahrt nach Helgoland. Ein Tisch quer auf
dem anderen, von 4 Leuten geschaukelt wie ein Schiff auf See und Lichtenberg
an Deck, das wilde Meer bejubelnd.

Bild
2: (v.l.n.r.) Peter Christoph Scholz , Agnes Giese , Linda Elsner , Jan
Reinartz , Franziska Lather
Lichtenberg auf dem simulierten Schiff während der Reise nach Helgoland
/ Fotos c Dorothea Heise
Jede/r Schauspieler/in
bekam einmal den Buckel aufgeschnallt. Der Stoffbuckel und eine Perücke
kennzeichneten den jeweiligen Lichtenberg.
"Sudelstück"
heißt es im Untertitel - und so gab sich die Inszenierung einen
Freifahrtschein für etliche obszöne Einlagen auch mal mit eindeutigen
Hüftbewegungen. Lichtenbergs "Fragment von Schwänzen"
(honi soit qui mal y pense) blieb nicht ohne Hinweis auf die mit wissenschaftlicher
Brillanz vorgetragene Kritik Lichtenbergs an den "Physiognomen".
So
hatte Lichtenberg Zunächst einmal mit einer Streitschrift, »Über
Physiognomik; wider die Physiognomen«, die Lavaters Lehre nach allen Regeln
der Kunst zerpflückt und schließlich vom gelehrten Salontisch fegt; und
später dann auch mit jenem satirischen »Fragment von Schwänzen« (>>DLF,
24.2.1999) die Physiognomen der Lächerlichkeit preisgegeben.
Seine Satire leitete zum Gespött der Physiognomen den menschlichen
Charakter aus Schwanzformen ab, beginnend mit Hundeschwänzen bis
hin zu den Perückenschwänzen der "Purschen". Allein
die Darstellung dieser Episode hätte durchaus Stoff für längere
Ausführungen geboten, um die Ernsthaftigkeit der wissenschaftlichen
Arbeit und die Übersetzung in Satire ausreichend zu würdigen.
Eine
wunderschöne Szene, die auch mit Szenenapplaus des Publikums bedacht
wurde, war "die Schöne und das Biest"-Analogie, diesmal
auf der Bühne getanzt, Linda Elsner mit langem roten Rock auf Stelzen
und das Biest (Jan Reinartz), als Gnom, als Mensch mit Behinderung
, mit Buckel und Tiermaske im Tanz mit ihr.

Linda Elsner , Jan Reinartz (c)
Dorothea Heise
Und dann das Thema
"Lichtenberg und die Frauen". Da haben wir in goest auch so
unsere Erfahrungen gemacht und eine umfangreiche Korrespondenz ausgelöst
als wir vorschlugen bei Promotionsfeiern sollte lieber Lichtenberg statt
des Gänseliesels geküsst werden. In einer daran anschließenden
Debatte kamen dann die >Verschwiegene
Schattenseiten Lichtenbergs ans Tageslicht, deren Problematik auch
im Theaterstück nicht thematisiert wurden.
Und weiter ging es
mit den biografische Stationen Lichtenbergs:
- Die tiefe Trauer über den Tod seiner jugendlichen Hausgehilfin,
die im Alter von 13 bis 18 bei ihm lebte - eine Episode
- die Geburt von vielen Kindern (bühnen-technisch gelöst in
Form von Kissen, die unter dem Rock hervorgezogen wurden und dann unter
Mama-Rufen über den Tisch gerollt wurden)
- die Lust auch nach seiner späteren Heirat mit seiner zweiten Frau
neuen Reizen nachzugehen.

Agnes Giese , Linda Elsner , Jan Reinartz, - (c)
Dorothea Heise // GCLs
Begehren
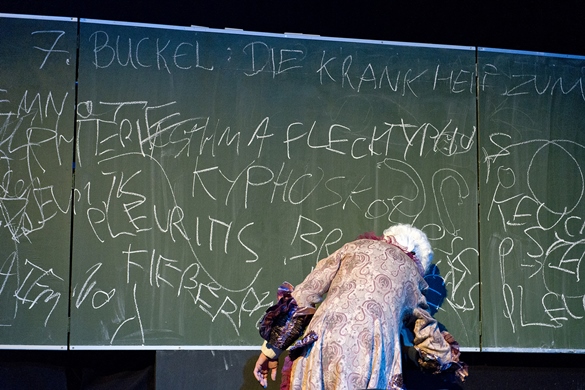
Karsten
Zinser als
GCL schreibt alle Krankheiten an die Tafel, die Lichtenberg gequält
haben.
Und schließlich
die letzte Episode, der Tod - als Folge einer Vielzahl von Krankheiten,
die mit seinem Buckel, der Kyphoskoliose
zusammen hingen. Insbesondere Asthma und Husten wurden über Gebühr
im Stück demonstriert, dass einen als Zuschauer selbst der Hustenreiz
würgend hochstieg. Und
dann in der Todesszene eine veritable Überraschung in einem opernreifen
Sopran von Franziska Lather. Der Bogen von der Geburt bis zum Tod
ist am Ende angekommen. Nun fliegen noch ein paar Stapel Zettel mit Lichtenbergsprüchen
ins Publikum: Aus .... und tosender Applaus.
Inszenierung
und Bühne Peter Schanz

Peter Schanz / foto goest
Kostüme
Gesa Kallsen
Musikalische Arrangements und Einstudierung Peter Christoph Scholz
Dramaturgie Tobias Sosinka
Weitere
Aufführungstermine:
04.03.2017, 20:00 10.03.2017, 20:00 18.03.2017, 20:00 31.03.2017, 20:00
29.04.2017, 20:00 17.05.2017, 20:00 09.06.2017, 20:00 30.06.2017, 20:00
01.07.2017, 20:00

foto: c / goest
|